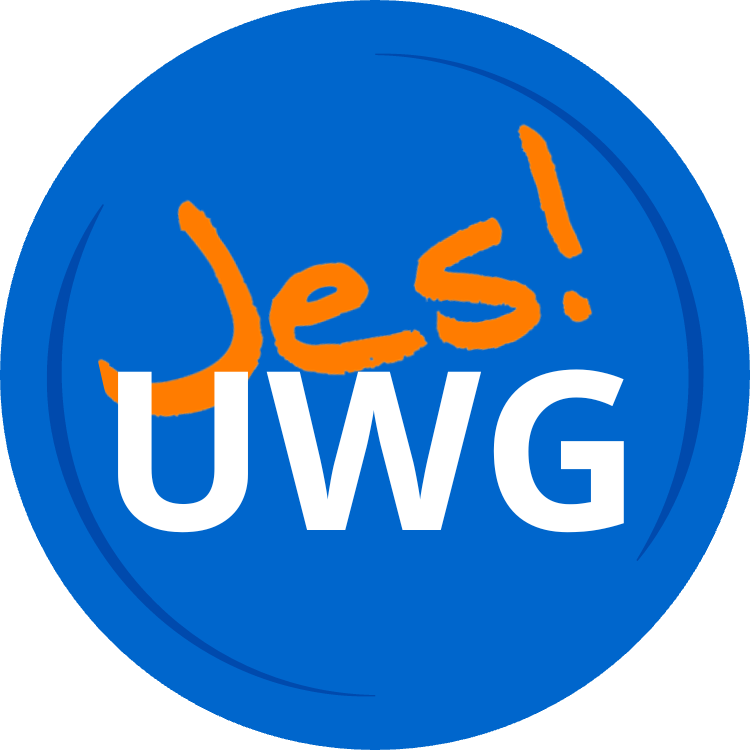Wir wollten den Landschaftsplan (1993) der Gemeinde Jesteburg aktualisieren. SPD, CDU und Grünen waren dagegen
VERANTWORTUNG FÜR NATUR UND UMWELT ÜBERNEHMEN
– Aktualisierung abgelehnt
Mit klaren, umweltpolitischen Konzepte wollten wir der Verwaltung Richtschnüre für ihre operative Arbeit an die Hand geben:
- Mit einem aktualisierten Landschaftsplan soll die weitere Entwicklung des Gemeindegebietes maßgeblich mitgestaltet werden.
- Mit einem Beleuchtungskonzept soll die nächtliche Sicherheit für die Bürger:innen erhöht und die laufenden Energiekosten gesenkt werden.
SPD, CDU und die Grünen haben beide Vorschläge abgelehnt.
Auch nach fast einem Vierteljahrhundert sei der jetzige Landschaftsplan als Richtlinie besser als ein zeitgemäß weiterentwickeltes Konzept und knapp 70.000 Euro für eine Aktualisierung seien zu viel Geld.
Weitere Informationen zum Thema Landschaftsplanung haben wir hier für Sie zusammengestellt.
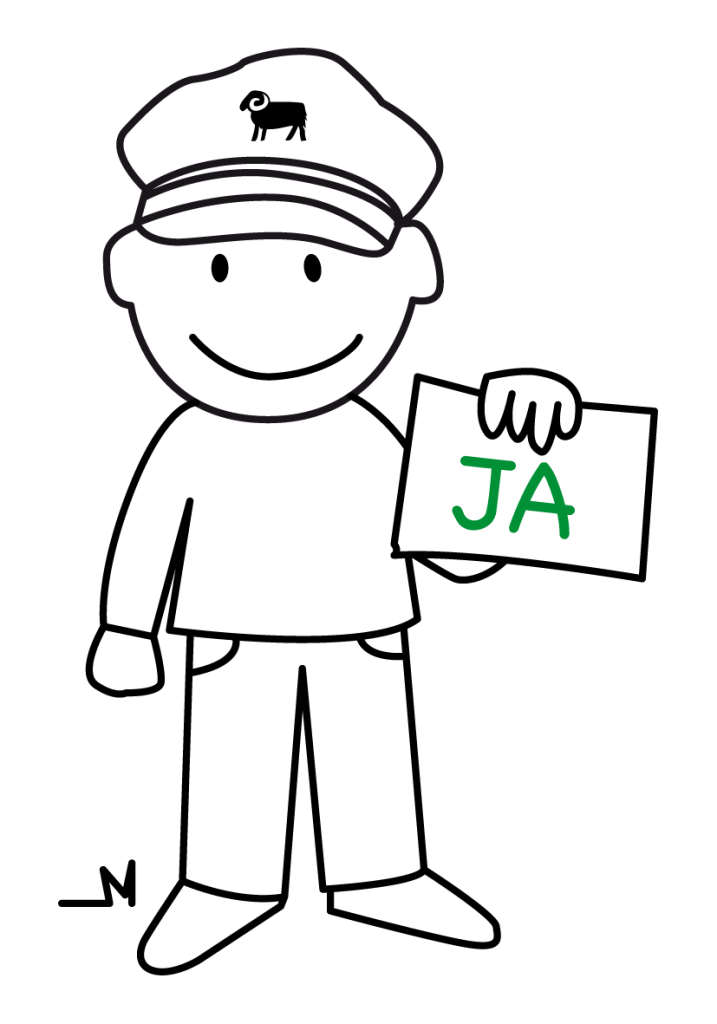
Unser Standpunkt
Der Landschaftsplan ist das gemeindliche Steuerungsinstrument für die weitere umweltverträgliche Nutzung von Gemeindeflächen. Umweltpolitische Richtungsentscheidungen auf Landkreisebene (Landschaftsrahmenplan) müssen sich auch in den politischen Diskussionen vor Ort wiederfinden. Wenn der Landkreis es für notwendig erachtet hat, den Landschaftsrahmenplan zu aktualisieren, dann sollte es selbstverständlich sein, dass auch Jesteburg ihre Planungen entsprechend überarbeitet.
Im alten Gemeinderat war diese Vorgehensweise eigentlich auch Konsens. Doch nun verneinen die etablierten Parteien jedwede Mitverantwortung an der weiteren zeitgemäßen Entwicklung des Ortes unter Umweltgesichtspunkten. Auf den völlig überalterten Landschaftsplan zu verweisen und ihn zur Richtschnur für politische Entscheidungen von heute, morgen und übermorgen zu erklären, kommt einem umweltpolitischen Offenbarungseid gleich.
Jetzt die rote Kostenkarte als Entscheidungsgrund für eine Nichtfortschreibung ins Feld zu führen, zeigt den gegenwärtigen Stellenwert des Landschaftsschutzes bei SPD, CDU und Grünen auf. Es scheint vorerst dabei zu bleiben: Zu allererst kommen die Investoren und dann, wenn es nichts kostet und die Siedlungsentwicklung nicht behindert, dann bekommt auch die Natur ihr Recht. Uns drängt sich der Verdacht auf, dass zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall Diskussionen aufkommen sollen, die womöglich die angestoßenen Bauvorhaben in Frage stellen.
Der Landschaftsplan Gemeinde Jesteburg (Stand 1993/1994)
(Auszüge)
2.3 BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG AUS LOKALER SICHT (LANDSCHAFTSPLAN)
2.3.1.2 Wichtige Bereiche für Arten und Lebensgemeinschaften aus lokaler Sicht
Es gibt 207 besondere Biotopflächen in Jesteburg
Weite Bereiche der Seeveniederung, des Jesteburger Moores und des Brettbachtales können als ’sehr wertvoll‘ … eingestuft werden.
Außerhalb der Niederungsbereiche sind es
- Toteislöcher und Kuhlen bei Itzenbüttel
- Moorbereiche südöstlich von Hassel
- Feuchtgrünlandflächen am Talweg in Jesteburg
- Bach bei Lohof
- Niederungsbereiche mit Fischteichen südlich der Bahn beim Osterberg
Flächendeckende zusammenfassende Bewertung
Besonders wichtige Biotopbereiche und Landschaftselemente
Mit mindestens regionaler Bedeutung
- die Seeveniederung in ihrem gesamten Verlauf
- das Brettbachtal
- weitere Seitenbäche der Seeve, wie z.B. der Pulverbach bei Holm
- die alten Eichen- und Buchenwaldbestände des Klecker Waldes
Mit lokaler Bedeutung
- die mit Gehölzen und (Obst-) Wiesen gegliederten Ortsrandbereiche von ltzenbüttel, Lüllau und Thelsdorf
- das Kornbachtal
- die Grünlandflächen westlich der Harburger Chaussee beim Komberg und am Lohof
- am Ohlenbroock südlich Hassel und
- einige Brachflächen werden als sehr wertvoll eingestuft.
Bedeutsame intakte Übergangszonen, Vernetzungsbiotope, Pufferzonen
- die Feldmarken um Itzenbüttel sowie zwischen Lüllau und Seppenser Mühle weisen als Vernetzungsbiotope funktionsfähige Gehölzstreifen auf
- die Ackerflächen am Hasseler Weg sind von Bedeutung für die ökologische Verbindung von Seeveniederung und Waldflächen Richtung Hassel, da hier das Siedlungsband Wiedenhof-Seevekamp unterbrochen ist.
Sonstige bedeutsame Bereiche aufgrund spezieller Arten oder Standortmerkmale
In diese Wertstufe werden vor allem die sonstigen Waldflächen eingeordnet, da sie unabhängig von ihrer meist artenarmen Vegetation insbesondere der Vogelwelt und dem Niederwild Brut- und Nahrungsbiotope sowie gute Deckungsflächen bieten.
Beeinträchtigte Biotope mit gutem Entwicklungspotential
Die Ackerflächen werden größtenteils dieser Wertstufe zugeordnet, da sie zwar Beeinträchtigungen durch die landwirtschaftliche Nutzung aufweisen, aber bei extensiverer Nutzung oder nach dem Brachfallen ein hohes Regenerationspotential besitzen, was sich auf den derzeitigen Ackerbrachen deutlich zeigt.
Beeinträchtigte Biotope mit geringem Entwicklungspotential
Zu dieser Wertstufe gehören vor allem die Siedlungsflächen, die aufgrund ihrer Versiegelung, Verkehrsbelastung und intensiven Nutzung nur eingeschränkte Lebensmöglichkeiten für Tiere und Pflanzen bieten und deren Regenerationsfähigkeit dauerhaft gestört ist.
Siedlung und Verkehr
… Negativ zu werten sind insbesondere die Inanspruchnahme der Waldbestände für einzelne Wohnungsbauten, aber auch für größere zusammenhängende Neubausiedlungen.
- Auch die Verdichtung der alten Waldsiedlungen hat erhebliche Folgen, dabei werden die Biotopqualitäten, die die ehemaligen Heidesiedlungen mit ihren großen waldbestandenen Grundstücken noch hatten, insbesondere für die Vogelwelt, sukzessive zerstört.
- Zu beobachten ist außerdem eine äußerst negative Konsequenz von Baugenehmigungen auf Waldgrundstücken: noch bevor der erste Spatenstich für das Gebäude erfolgt, wird als erstes der gesamte Gehölzbestand gefällt und gerodet.
- Als weiteren Beeinträchtigungsfaktor ist die allmähliche Bebauung der Seeveniederung von den Seiten her zu nennen. Insbesondere im Ortskern an der Brücke Richtung Asendorf ist zu befürchten, dass die ökologische bedeutsame Verbindung entlang des Seevelaufes über Wiesen, Gehölze und Bruchwald verlorengeht.
Als besondere Konfliktbereiche für die Sicherung der Biotopfunktionen sind die folgenden Bereiche einzustufen:
- Barrierenwirkung der Bahntrasse in der Seeveniederung und beim Osterberg
- Barrierenwirkung der Harburger Chaussee an bedeutsamen Vernetzungsbiotopen
- Campingplatz im Kornbachtal
- Ackerflächen, Aufschüttungen und Gebäude in der Seeveniederung
- Kanuwanderungen und Bootseinsetzplätze an der Seeve
- Gebäude im Brettbachtal
3.2 ZIELKONZEPT AUS LOKALER SICHT (LANDSCHAFTSPLAN)
3.2.1 Allgemeines Zielkonzept
Die wesentlichen allgemein geltenden Entwicklungsziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für Jesteburg lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Die deutlich wahrnehmbare naturräumliche Gliederung in Geest- und Niederungsflächen mit vielfältigen, standortbezogenen Biotopen und Landnutzungen ist zu erhalten bzw. wiederherstellen.

Die Siedlungsentwicklung stößt in Jesteburg an ihre Grenzen. Sie muß sich auf ein solches Mindestmaß beschränken, dass einerseits eine gemäßigte Ortsentwicklung im Rahmen der bisherigen Schwerpunkte Wohnen, Fremdenverkehrsgewerbe und Erholung möglich bleibt, andererseits aber stärker die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege berücksichtigt werden. Um eine langfristige Entwicklung der Gemeinde zu sichern, ist mit den verbliebenen Flächenreserven schonend umzugehen und eine stufenweise Entwicklung anzustreben. Tabuzonen wie Seeveniederung, Bachtäler und Waldflächen sind von zusätzlicher Bebauung und Verkehr freizuhalten.

Die naturnahen bzw. halbnatürlichen Landschaftsbestandteile, wie Eichen- Mischwälder, Bruchwälder, Niedermoorflächen, Nasswiesen und Röhrichte, sind vor allen Beeinträchtigungen zu schützen und durch entsprechende Maßnahmen in ihrem Flächenanteil zu erhöhen. Durch Anlage von Feldgehölzstreifen und Saumbiotopen ist die Vernetzung der Biotope zu fördern.

Örtliche Belastungen des Naturhaushaltes, z.B. Versiegelung von offenen Bodenflächen, stoffliche Einträge durch Landwirtschaft und Gartennutzung, Verkehrsimmissionen sowie unnötige Beunruhigung von Tieren oder Beschädigung von Pflanzen sind zu verhindern oder auf ein Minimum zu beschränken.
Freihaltung des siedlungsnahen Landschaftsraumes von Bebauung
Die Freihaltung des siedlungsnahen Landschaftsraumes von Bebauung, d.h. die Beibehaltung des vorhandenen Ortsrandes, ist vor allem in folgenden Bereichen von Bedeutung:
- Am östlichen Ortsrand von Itzenbüttel, um eine deutlich wahrnehmbare Trennung der Ortsteile Itzenbüttel und Jesteburg zu bewirken.
- Im Kornbachtal, um den Talraum, der ohnehin schon stark beeinträchtigt ist, erlebbar zu erhalten und um den empfindlichen Naturhaushalt der Niederung vor Belastungen zu bewahren.
- Die Grünlandflächen westlich der Harburger Straße am Itzenbütteler Heuweg, die derzeit für eine deutliche Gliederung der Jesteburger Ortseingangssituation sorgen.
- Die Niederung am Kirchberg, um ein Zusammenwachsen von Siedlung und Waldflächen zu verhindern.
- Die Niederung westlich des Gewerbegebietes am Allerbeeksring, um diesen entwicklungsfähigen Biotopkomplex vor Belastungen zu schützen.
- Die Seeveniederung beiderseits der Brückenstraße und am Pfarrgarten, wo der offene Niederungscharakter schon durch die vorhandene Bebauung verlorenzugehen droht.
- Die Baulücke am Seevekamp sollte als Blicköffnung (‚Landschaftsfenster‘) zur Seeveniederung freibleiben.
- In Lüllau, wo schützenwerte, durch Obstwiesen und alte Hofstrukturen geprägte Ortsrandbereiche und der freie Blick in die Seeveniederung in der Ortsmitte erhalten werden sollten.
- Der Rand des Brettbachtales südlich der Asendorfer Straße als Schutz dieses empfindlichen Biotopkomplexes und Freihaltung der Niederungslandschaft.
Erhaltung des Waldsiedlungscharakters ohne weitere bauliche Verdichtung
Ein Teil der Jesteburger Waldsiedlungen, die sich größtenteils aus ehemaligen Wochenendhausgrundstücken entwickelt haben, weist
- durch die besondere Architektur der Häuser,
- durch die Erhaltung eines naturnahen Waldbestandes auf meist großen Grundstücken und
- durch die Beschränkung der Gartennutzung auf das unmittelbare Hausumfeld einen eigenen Charakter auf,
der zur Bereicherung von Orts- und Landschaftsbild führt und den Naturhaushalt und die heimische Pflanzen- und Tierwelt wenig beeinträchtigt.
Soweit diese Flächen, in ihrer jetzigen Bestandsqualität und -dichte erhalten bleiben, kann dies aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes toleriert werden. Keinesfalls sollten jedoch diese zurückhaltende Bebauung, die historisch gewachsen und erklärbar ist, den Anlass bieten, eine weitere Bebauung und Verdichtung zuzulassen. Die oben beschriebenen Qualitäten würden verlorengehen und der mögliche Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild wäre ähnlich schwerwiegend wie bei einer Neubebauung auf Waldflächen.
Der Verlust, der durch eine nachträgliche Verdichtung von Waldsiedlungen eintritt, ist bei mehreren Flächen u.a. am Seevekamp, Reindorfer Osterberg, Royberg und Hundsberg zu beobachten. Da Schutzbestimmungen des Naturschutzrechts hier kaum greifen, ist durch enge Festsetzungen in Bebauungsplänen, z.B. geringe Grundflächenzahl, Begrenzung der Wohnungszahl und Einzelhausbebauung, ein Bestandsschutz durchzusetzen.
Sicherung und Entwicklung von orts- und landschaftsbildtypischen dörflichen Grünstrukturen
Besonders in den Ortsteilen Itzenbüttel, Lüllau und Thelstorf, aber auch im Ortskern Jesteburgs, sind unbedingt schützenswerte Grün- und Freiraumstrukturen vorhanden, die in gleicher Weise wie die historischen Gebäuden das ‚dörfliche‘ Ortsbild prägen und den Orten eine unverwechselbare Identität geben, z.B.:
- Feldsteinmauern/-pflaster, Hofbäume, Eichenhaine, Bauerngärten und Obstwiesen in Itzenbüttel
- Heide und Heidschnucken-Wiese beim ‚Rüsselkäfer‘
- Hofensemble Lohof mit Feldsteinpflaster, Hecken, Hofwiese und Allee
- alter Baumbestand im Ortszentrum Jesteburg
- Wassermühle, Mühlenteich, Feldsteinmauern/-pflaster, Bauerngärten, Hofbäu me und Eichenhaine in Lüllau und Thelstorf
- Hofeichen in Hassel

Eine Sicherung dieser Elemente sollte möglichst über Festsetzungen in Bebauungsplänen erfolgen. Soweit die Flächen im Gemeindebesitz sind, ist die Pflege und Unterhaltung dieser Flächen darauf abzustimmen.
Im Dorferneuerungsplan für Lüllau und Thelstorf (vgl. NLG, 1990) sind eine Reihe von zu befürwortenden Gestaltungs- und Pflanzmaßnahmen aufgeführt, die vorhandene Qualitäten aufnehmen und weiterentwickeln.
Die folgende Aussage wird ausdrücklich unterstützt: Es gibt „… Grenzen für die Entwicklung eines Dorfes, wenn nicht der Zusammenhang zwischen Landschaft und Siedlung, der ganz entscheidend das ‚Dörfliche‘ prägt, aufgehoben werden soll“ (S.151).
Pflegeplan umsetzen bzw. erstellen
In Bereichen mit komplexen Problemstellungen von Naturschutz und Landschaftspflege ist es erforderlich, die Entwicklungsziele und Maßnahmen in Grünordnungsplänen oder Pflegeplänen weiter zu detaillieren. In zwei Gebieten sind entsprechende Pläne vorhanden, die umgesetzt werden sollten:
- Grünordnungsplan Kornbachtal (DERBOVEN, 1988)
- Landschafts-Pflegeplan Brettbachtal (DERBOVEN, 1989)
Generell wird es notwendig sein, für die o.g. Schwerpunkträume für Ersatzmaßnahmen und für weitere Flächen im Lauf von Unterschutzstellungsverfahren Pflegepläne aufzustellen.
Für die folgenden Bereiche wird dies vordringlich empfohlen:
- Itzenbütteler Teiche
- Bruchwald Seeveniederung südwestlich Allerbeek
- Jesteburger Moor
- ehem. Bodenabbau Kamerun
- Pulverbachtal
- Fischteiche Hassel / Quellgebiet Brettbachtal
6. BERÜCKSICHTIGUNG VON NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE BEI GEMEINDLICHEN AUFGABEN UND IM REGELUNGSBEREICH ANDERER BEHÖRDEN UND ÖFFENTLICHEN STELLEN
6.2 SIEDLUNG (WOHNEN UND GEWERBE)
Die Gemeinde Jesteburg ist aufgrund ihrer attraktiven Lage und des hohen Wohnwertes einem erheblichen Siedlungsdruck ausgesetzt, wobei das Risiko besteht, dass die ursprünglichen Qualitäten der Ortsteile und der umgebenden Landschaft verlorengehen. …

Bei einem Vergleich von Flächennutzungsplan und aktuellem Bebauungsstand wurde festgestellt, dass erhebliche Flächenreserven durch Baulücken oder nicht ausgeschöpfte Baurechte bestehen. Die Ergänzung des Bestandes sollte deshalb Vorrang vor der Ausweisung neuer Bauflächen haben. Auch dabei ist selbstverständlich die Umweltverträglichkeit des Bauvorhabens zu prüfen: die nachträgliche Verdichtung in lockeren Waldsiedlungen entspricht nicht den Zielsetzungen des Landschaftsplanes.
Die folgenden gekürzten Aussagen des Landschaftsrahmenplanes sind darüberhinaus als allgemeingültige Maßstäbe bei der weiteren baulichen Entwicklung zu berücksichtigen:
- Grundsätzlich muß gelten, dass die Entwicklung von Gemeinden derart erfolgt, dass ihre besonderen Eigenarten erhalten bleiben. Die gewachsenen, das Erscheinungsbild der Städte und Dörfer oder die Lebensweise der Bewohner prägenden baulichen und landwirtschaftlichen Strukturen werden erhalten, oder unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse weiter entwickelt (Quelle: Regionales Raumordnungsprogramm).
- Eine Entwicklung von Siedlung, Industrie und Gewerbe darf nur im Rahmen ihrer Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgen, d.h. dass ökologisch wertvolle Bereiche und Funktionen des Naturhaushaltes nicht beeinträchtigt werden dürfen.
- Keine Beanspruchung von wichtigen Bereichen für Arten- und Lebensgemeinschaften.
- Keine Beanspruchung von Überschwemmungsgebieten.
- Keine weitere Einengung von Talräumen zur Gewährleistung einer natürlichen Fließgewässer-Charakteristik (dies gilt für alle Ortschaften an Fließgewässern).
- Vermeidung eines Zusammenwachsen von Gemeinden am Geestrand. Aus Gründen der Erhaltung des Landschaftsbildes und ökologischer Austauschfunktionen müssen ausreichende Freiräume erhalten bleiben.
- Keine Bebauung, die das Landschaftsbild in ausgesprochen charakteristischen Bereichen im besonderen Maße beeinträchtigen (beispielsweise prägende Höhenzüge, an denen eine Bebauung weithin sichtbar wird).
- Beschränkung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige, dem Anspruch gerecht werdende Maß (bei Wege-, Platz- und Hofflächen); funktionslos gewordene Versiegelungen sind zu beseitigen.
- Oberflächenwasser von versiegelten Flächen möglichst dezentral dem Boden zuführen (Grundwasser-Neubildung). Im Bedarfsfall muß das Oberflächenwasser vor einer Versickerung gereinigt werden.
- Verzicht auf dauerhafte Grundwasser Absenkungen, die zur Sicherung von Bauwerken notwendig wären.
- Berücksichtigung der Eingriffsregelung in Bauleitplänen und rechtswirksame Bereitstellung von Flächen für Ausgleich und Ersatz in B-Plänen (derzeit extrem defizitiär).
- Dorfgestaltung unter Berücksichtigung der historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen und Baustile:
- Erhaltung typisch-historischer Bausubstanz
- Einpassung in Proportion, Farbe, Gebäudestellung, Dachneigung und -ausbildung (typisch sind langgestreckte Baukörper mit steiler Dachneigung)
- möglichst Verwendung gleicher oder ähnlicher Materialien keine
- Durchmischung alter Dorfstrukturen mit Wohn- und Gewerbebebauung
- Erhaltung und Entwicklung dorftypischen Grüns
- Verwendung von Dorf- und Bauerngartenpflanzen in Vor- und Hausgärten
- Verzicht auf typische städtische Gartenelemente, wie Konifereneinfassungen und „Rasenteppich“
- Erhaltung und Ergänzung von dorftypischen Straßen-, Hof- und Hausbäumen (Eichen, Linden, Buchen, Eschen, Roßkastanien)
- Fassadenbegrünung durch dorf- und landschaftsraumtypische Rank- und Kletterpflanzen oder Spalierobst
- Erhaltung und Renaturierung innerörtlicher Wasserflächen (Dorfteiche, Fließgewässer, Gräben, ggf. Aufhebung von Verrohrungen)
- Erhaltung und Verbesserung von Aufenthaltsbereichen (Nist-, Aufzucht-, Schlaf- und Oberwinterungsplätze) für die typische wildlebende Dorffauna
- Einfriedung ortstypisch mit Lattenzäunen, Schnitthecken oder Feldsteinmauern vornehmen
- Kein ortsbildzerstörender Ausbau von Straßen und Plätzen
- Flächenbefestigungen aus Feldsteinen, Natursteinpflaster u.ä. möglichst erhalten ggf. ergänzen, um Restflächen zu verbinden, ästhetisch aufzuwerten und eine sinnvolle Funktion zu geben
- Erhaltung und Verbesserung der Einbindung von Ortsrändern in der freien Landschaft
- Erhaltung und Entwicklung innerstädtischen Grüns unter Berücksichtigung stadtökologischer Belange und der Vernetzung einzelner Lebensräume
- Vermeidung von Immissionen durch Anwendung neuester Techniken. Veraltete Techniken sollten im wirtschaftlich und sozial vertretbarem Rahmen durch neue ersetzt werden
- Die Lage von Emittenten sollte so ausgewählt werden, dass Menschen wie auch empfindliche Lebensräume möglichst geschont werden. Eine ausreichende landschaftsgerechte Abpflanzung sollte zum Rückhalt von Immissionen und zur optischen Eingliederung in jedem Fall vorgenommen werden.
Als Umsetzungsinstrument dieser Anforderungen aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege an Siedlung, Industrie und Gewerbe dient in erster Linie die Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch, also der Flächennutzungsplan und die Bebauungspläne.
Da der Flächennutzungsplan neu aufgestellt werden soll, bieten sich in Jesteburg sehr gute Möglichkeiten einer landschaftsgerechten Siedlungsentwicklung. Sind aufgrund der Aufstellung von Bebauungsplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, so ist gemäß § 8a BNatSchG … über die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im entsprechenden Bebauungsplan zu entscheiden; dazu gehört auch die Darstellung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Der Grünordnungsplan erarbeitet dafür die fachlichen Grundlagen und Entscheidungsmaßstäbe.
Weitere Möglichkeiten zur Durchsetzung der landschaftsplanerischen Entwicklungsziele in der Siedlungsplanung ergeben sich für die Gemeinde vor allem durch den vorsorglichen Flächenaufkauf, um expansive Bodenwertsteigerungen zu verhindern, die landschaftspflegerische Maßnahmen erheblich erschweren. Auch durch die vorliegende Dorferneuerungsplanung für Lüllau und Thelstorf bieten sich Durchsetzungschancen. Nicht zuletzt kann die Gemeinde durch umweltfreundliches Bauen und sparsamen Ressourcenverbrauch eine Vorbildfunktion für private Bauherren und Baugesellschaften übernehmen.
7. ANFORDERUNGEN AN DIE BAULEITPLANUNG
7.1 AUSSAGEN DES LANDSCHAFTSRAHMENPLANES
Für die Darstellung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft ist die Bauleitplanung ein wichtiges Instrument.
§1 Baugesetzbuch ‚Aufgaben, Begriffe und Grundsätze der Bauleitplanung‘ stellt in Abs. 5 die Forderung, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. In Pkt. 7 dieses Absatzes ist weiter ausgeführt, dass „die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft und des Bodens einschließlich seiner Rohstoffvorkommen sowie das Klima“ bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen sind, d.h., dass in der Bauleitplanung vor einer Festschreibung von Flächennutzungen eine ausreichende ökologische Bewertung der betroffenen Flächen sowie die zukünftigen Auswirkungen durch die vorgegebene Nutzungsänderung erfolgen muß.
Wie im Flächennutzungsplan sollten auch im Bebauungsplan die rechtlichen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege genutzt werden. So sollte verstärkt von §9 Abs. 1 Nr. 20 Gebrauch gemacht werden, der die Festsetzung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie der entsprechenden Flächen hierfür vorsieht.
Für eine umfassende Betrachtung der ökologischen Verhältnisse kann es sinnvoll sein, den Bebauungsplan durch einen Grünordnungsplan zu ergänzen.
Folgende allgemeine Hinweise werden für die Gemeinde Jesteburg gegeben:

- Freihalten des Seevetalraumes von Bebauung
- Sicherung typisch entwickelter Dorfstrukturen
- landschaftsgerechte Eingrünung von Ortsrändern
- Berücksichtigung ökologischer Belange bei derzeit geplanten Straßenbauvorhaben
- Entwicklung der Seeve und ihrer Nebenbäche in Siedlungsräumen
7.2 AUSSAGEN ZUR BAULEITPLANUNG AUS LOKALER SICHT (LANDSCHAFTSPLAN)
7.2.1 Aussagen zum Flächennutzungsplan
Bei der geplanten Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für Jesteburg muß der Landschaftsplan als Abwägungsgrundlage für den Belang Natur und Landschaft herangezogen werden. Die Gemeinde soll nach § 6 NNatG im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan auf den Zustand von Natur und Landschaft eingehen und darlegen, wie weit die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt worden sind.
Die folgenden landschaftsplanerischen Ziele und Maßnahmen sind als wesentliche Aussagen zur Übernahme in den Flächennutzungsplan vorzuschlagen:
- Vorrangig Bestandsauffüllung und darüber hinaus nur behutsame Ergänzung der vorhandenen Siedlungsflächen unter Berücksichtigung der im Landschaftsplan dargestellten Schutzgebiete und schutzwürdigen Landschaftsteile sowie der flächendeckenden Bewertung in den Karten A8-A11
- Ausweisung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft im Bereich der sog. Schwerpunkträume für Ersatzmaßnahmen (Pool-Lösung s.u.)
- Schutzgebiete und schutzwürdige Landschaftsteile als Vorbehaltsflächen (nachrichtliche Übernahme)
- Sicherung des Waldbestandes und der naturnahen Waldsiedlungen vor weiterer Bebauung
- Freihaltung der Seeveniederung und ihrer Seitentäler von Bebauung und Infrastruktureinrichtungen und -anlagen
- keine Ausweisung neuer Verkehrs-Trassen außerhalb von geschlossenen Baugebieten
Die Ausweisung möglicher neuer Baugebiete ist nur nach Abwägung mit Standortalternativen vorzuschlagen. Die Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild sowie auf die Folgen für die Verkehrsinfrastruktur und soziale Einrichtungen ist zu prüfen.
Im Erläuterungsbericht des F-Planes ist darzulegen, wie dem Gebot des sparsamen Umganges mit Grund und Boden Rechnung getragen wird.
Durch die Schaffung eines Ersatzmaßnahmen-Pools auf der Grundlage des § 8a BNatSchG sollte die Realisierung und planerische Absicherung von Ausgleichserfordernissen bei Eingriffen in Natur und Landschaft verbessert werden. Auf diese Weise können die bei mehreren Eingriffen entstehenden Ausgleichsansprüche gebündelt und auf der Grundlage eines zusammenhängenden Landschaftspflegekonzeptes in einem Gebiet konzentriert werden, das soweit möglich vorher in gemeindeeigenen Grundbesitz übergegangen ist.
Es ist unbedingt empfehlenswert, die Abrechnung der Ersatzmaßnahmen mit den Eingriffsverursachern über eine Gemeindesatzung gemäß § 8a Abs. 5 BNatSchG zu regeln, um Einsprüche und eine Benachteiligung Einzelner zu vermeiden.
Der Flächennutzungsplan sollte eine Grobbilanzierung von möglichen Eingriffen und den vorgesehenen Ausgleich enthalten.
7.2.2 Aussagen zum Bebauungsplan
Wie beim Flächennutzungsplan, muß auch beim Bebauungsplan in der Begründung auf den Zustand von Natur und Landschaft eingegangen und dargelegt werden, wie weit die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt worden sind.
Sind aufgrund der Aufstellung von Bebauungsplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, so ist gemäß § 8a BNatSchG (eingefügt nach dem Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) über die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im entsprechenden Bebauungsplan zu entscheiden. Dazu gehören auch die Darstellungen und Festsetzungen, die die Beeinträchtigungen des Eingriffes auf Natur und Landschaft mindern, ausgleichen und ggf. ersetzen sollen. Über den Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen hat die planaufstellende Kommune in der Abwägung nach § 1 BauGB Abs. 5 u. 6 zu entscheiden. Der Grünordnungsplan erarbeitet dafür die fachlichen Grundlagen und Entscheidungsmaßstäbe. Die Darstellungen des Landschaftsplanes sind zu berücksichtigen.
Der Grünordnungsplan konkretisiert die Darstellungen des Landschaftsplanes, der maßstabsgemäß keine parzellenscharfe Abgrenzung von Schutzgebieten, schutzwürdigen Landschaftsteilen sowie Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vornehmen kann. Die Nicht-Aufstellung eine Grünordnungsplanes kann u.U. zu einem Abwägungsfehler führen, der die Rechtswidrigkeit der Planentscheidung nach sich zieht (vgl. LOUIS, 1990).
- Der Grünordnungsplan hat keine eigene Rechtswirksamkeit, so dass möglichst viele Vorschläge als Festsetzung in den Bebauungsplan übernommen werden sollten. Von besonderer Bedeutung für die Sicherung und Entwicklung des Naturhaushaltes ist die Beeinflussung der überbaubaren Grundstücksfläche und der Flächen, die von Bebauung freigehalten werden bzw. Nutzungsfestlegungen, wie Wald, Grünfläche oder Landwirtschaft, erhalten. Im folgenden werden einige wesentliche Festsetzungsinhalte genannt, die darüberhinaus in Grünordnungsplänen vorgeschlagen werden sollten:
- Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, soweit diese nicht nach anderen Vorschriften getroffen werden können
- Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft insbesondere für den Ausgleich des Eingriffs 3 Anpflanz- und Erhaltungsgebote für Gehölze
- Dach- und Fassadenbegrünung
- Sicherung von morphologischen Geländebestandteilen, z.B. Reliefhöhe, feuchte Senken, Geländekanten
- Behandlung, Versickerung und Abführung der anfallenden Oberflächenwasser
- Angaben zur Wege- und Stellplatzbefestigung
- Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
In der Regel sollte der Bebauungsplan so abgegrenzt werden, dass der Ausgleich im Plangebiet möglich ist, um eine unmittelbare rechtliche und funktionale Zuordnung zum Eingriff zu gewährleisten. Sollte dies nicht möglich oder nicht sinnvoll sein, kann der Bebauungsplan zwei Geltungsbereiche umfassen (vgl. GIERKE 1993).
Der Bebauungsplan muß eine Bilanzierung des Landschaftszustandes vor und dem Eingriff beinhalten, aus der eine nachvollziehbare Ausgleichsregelung abgeleitet werden kann. Die Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu Eingriffsflächen sollte möglich sein.